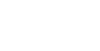Sow, jetzt sind bei Beiträge angekommen und ihr dürft abstimmen bis zum
20.4. 2009!
Viel Spaß ^_^
Ist weiß besser als schwarz?
-
Nein, aber anders
(von Heralina - Unentschieden)
Hallo! Mein Name ist Olakunde. Das ist afrikanisch und bedeutet „der Tapfere ist angekommen“. Ich stamme nämlich selbst vom „schwarzen Kontinent“. Aber meine Haut ist weiß. Weiß wie deine.
Nein, es liegt nicht an einem Gendefekt oder Ähnlichem. Ich bin ein Findelkind.
Wer meine leiblichen Eltern sind, weiß niemand. Nur, dass sie weiß waren. Weiß wie ich. Vermutlich wurden sie vom Sumpffieber dahingerafft und ich habe als Einziger überlebt.
Meine Adoptiveltern in dem nigerianischen Dorf Mahlasela sagten, es sei ein Wunder. Sie waren sehr liebenswürdig zu mir und behandelten mich nicht anders, als ihre eigenen Kinder. Wenn man mich nicht mitzählt, waren es zwölf, während der Zeit, die ich bei ihnen lebte. Sicher kamen nicht alle durch. Es gab immer ein trauriges Fest, wenn jemand gestorben war. Da wurde viel gesungen und gebetet. Der Leichnam, ob von Mann, Frau oder Kind, wurde auf einem Holzfloß zu dem großen Fluss Niger getragen, dort entzündet und dann zu Wasser gelassen.
Aber vor allem die Ältesten des Stammes wollten mich nur ungern an ihren Zeremonien teilhaben lassen. Sie sagten, dass es die Totengeister verärgern könnte, wenn ein Weißer den Traditionen zusähe, sodass den Verstorbenen der Zutritt ins Jenseits verwehrt bliebe und ihre Seelen keine Ruhe finden würden.
Meine Eltern allerdings setzten sich dafür ein, dass ich nicht außen vor behandelt wurde, und veranlassten so auch meine Anwesenheitserlaubnis bei traditionellen Zeremonien.
Trotzdem gab es im Stamm immer noch sehr viele, die mich nicht als einen der Ihren akzeptieren wollten. Ich verwendete ihre Sprache, ich kannte ihre Geschichten, ihre Bräuche, ich war dort aufgewachsen wie sie und doch blieb ich für sie immer ein Fremder. Während die Erwachsenen hinter vorgehaltener Hand Gerüchte über mich und meine Herkunft entfachten, trieben die Kinder öffentlich Spott über meine Hautfarbe und lachten. Sie sagten Dinge wie: „Als Oshumare den starken Regen angekündigt hat, bist du trotzdem hinausgegangen und hast getanzt. Als Strafe für deinen Ungehorsam hat das göttliche Wasser dir die Farbe ausgewaschen!“
Oshumare ist in dem Glauben des Stammes ein sehr hoher Gott gewesen. Eine Legende besagt, dass vor vielen, vielen Jahren eine große Dürre das Land heimgesucht hatte. Die Menschen baten so inständig den großen Gott um Wasser zum Trinken und für die Ernte, sodass er sich erweichen ließ und einen gewaltigen Regenguss ankündigte. Aber er warnte, dass jeder sich in einen festen Unterschlupf zurückziehen solle, weil die himmlische Wasserflut so gewaltig sein werde, dass sie einen Menschen, der draußen herumlief, mühelos erschlagen könne.
Man behauptete also, dass ich Glück gehabt hätte, da der regen mir bloß die Farbe und nicht auch noch das Leben genommen hatte.
Meine Altersgenossen waren gerade in den Mannestand aufgenommen worden – mir wurde die Ehre aufgrund meines Ungehorsams gegenüber einem Gott untersagt und ich würde auf ewig ein Junge bleiben müssen – als uns eine Reisegruppe mit einer Menge beladener Lasttiere besuchte. Ich war fasziniert von ihnen, denn die Männer waren alle weiß.
Nur wenige aus dem Stamm trauten sich, mit ihnen zu kommunizieren. Die meisten verbaten ihren Kindern sogar, sich zu zeigen, während die Fremden da waren.
Anfangs hatte auch ich ziemlich viel Angst und hielt mich fern. Doch als ich sah, dass einige Erwachsene - allen voran meine Adoptiveltern - abends am Feuer mit ihnen scherzten und Spaß hatten, gesellte ich mich schon nach wenigen Tagen dazu. Die weißen Gäste blieben mehrere Wochen und lernten im Laufe der Zeit, unsere Sprache besser zu verstehen und zu sprechen. Bald konnte ich mich mit ihnen richtig unterhalten. Und wenn wir die Worte des anderen einmal nicht zu deuten vermochten, gebärdeten wir uns mit Händen und Füßen. Das war immer sehr lustig und wir hatten viel zu lachen.
Nachdem der Sommer vorbei war, teilte uns der Anführer der Gruppe mit, dass es für sie nun an der Zeit war, aufzubrechen. Ich war traurig, denn die Fremden kannten viele interessante Geschichten. Zum Beispiel hatten sie einmal davon erzählt, dass es bei ihnen Transportmittel aus Blech gab, die von selbst vorwärtskamen, ohne dass sie von einem Tier gezogen wurden. Oder dass es Häuser gab, in denen Bilder auf einer Rolle mithilfe von Licht auf eine Wand geworfen und dort ganz schnell abgespielt wurden, sodass es aussah, als würden sie sich bewegen. Diese Gebäude nannten sie Kinos. Sie sprachen auch davon, dass die Häuser, in denen sie lebten, mehrere Zimmer hatten und dass es in manchen Becken gab, in die das Wasser von selbst hineinlief, wenn man bloß an einer Schraube drehte.
Mir kam es so vor, als ob diese weißen Menschen aus einer anderen Welt kämen. Auch die anderen Angehörigen des Stammes, die den Mut gehabt hatten, aufmerksam zuzuhören, staunten in Ehrfurcht.
Als die Fremden nun gehen wollten, bat ich sie, mit ihnen kommen zu dürfen. Ich mochte endlich unter Menschen leben, die aussahen, wie ich.
Nach längerem Überlegen stimmten sie zu, aber meine schwarzen Brüder und Freunde wiesen sie ab. Sie sagten, dass die in ihrem Land nicht besonders gerne gesehen würden. Auch gaben sie mir einen anderen Namen, um zu verschleiern, woher ich kam. Sie nannten mich Sven. Später erfuhr ich, dass das „junger Krieger“ bedeutet und ich war ihnen dankbar dafür.
Die Reise dauerte sehr lange, doch endlich erreichten wir mit einem großen Schiff die Stadt, aus der die Weißen kamen. Vielleicht stammten auch meine Eltern von hier, Mir wurde schnell klar, dass die Suche nach ihnen aussichtslos war. Die Stadt hier erschien mir so riesig, dass mein altes Dorf mehr als eine Million Mal dorthinein gepasst hätte.
Von den Dingen, die es hier angeblich gab, bekam ich nur wenig zu sehen. Vereinzelt ein paar dieser Metallmonster, auf denen die Leute ritten, aber das war alles. Keine bewegten Bilder, kein fließendes Wasser und auch kein Licht, das auf Knopfdruck statt mit Feuer funktionierte.
Das und dass die Fremden mich einfach im Stich gelassen hatten, brachte mich auf den Gedanken, dass sie mich von vorne bis hinten betrogen hatten. Ich war enttäuscht und stand nun gänzlich ohne Material da. Außer der Jacke und der Hose, die man mir statt des bunten Tuches gegeben hatte, hatte ich nichts mehr.
Dieses Land hier war ein sehr unfreundliches Land. Wenn daheim jemand Hunger litt, schenkte man ihm etwas zu essen. Aber hier wurde man ausgelacht und verprügelt, wenn man auch nur um Almosen bat.
Eines Tages, als ich wieder einmal durch die Straßen zog und im Müll nach etwas Essbarem suchte, sah ich, wie vier weiße Männer jemanden gepackt hatten und ihn gegen eine Hauswand drückten, während sie ihn mit einem Messer bedrohten. Er war schwarz.
Mutig ging ich auf sie zu. Was außer meinem unlebenswerten Leben hatte ich schon zu verlieren?
„Hallo“, sagte ich in gebrochenem Englisch, der Sprache, die man hier sprach und die ich einwenig von den Fremden gelernt hatte, „was wollt ihr von dem Mann?“
Sofort wurde auch ich in den Schwitzkasten genommen und ein anderer tastete mich ab.
„Du kannst den loslassen, der hat nix“, meinte er schließlich.
Der, der mich festhielt, brummte und machte seinen Griff locker, sodass ich mich ihm entziehen konnte. Da reagierten sie plötzlich ganz schnell, stachen auf den schwarzen Mann ein, rissen einen kleinen Beutel an sich und rannten aus der Gasse fort.
Erschrocken starrte ich den Dunkelhäutigen an. Unter seinem schmutzigen Hemd quoll Blut hervor und er hielt sich die Brust.
„Danke“ sagte er und setzte sich an die Hauswand lehnend hin. Ich nickte ihm zu und ließ mich neben ihm nieder.
„Kann ich dir helfen?“, fragte ich, weil er mir leidtat.
Er schüttelte stumm den Kopf und nach einer Weile richtete er eine Frage an mich. „Wie kommt ein Weißer dazu, einem wie mir helfen zu wollen?“, sagte er.
„Warum? Du bist ein Mensch, wie ich“, erwiderte ich.
Der Mann hielt den Blick gesenkt und antwortete: „Ich bin schwarz.“ Es klang beinahe so, als würde er sich dafür schämen.
„Na und? Was würde ich dafür geben, deine Haut zu haben. In meiner Heimat wurde ich ständig gehänselt, weil ich anders aussah als sie.“
Er blickte auf und sah mich erstaunt an. „Woher kommst du?“, fragte er dann.
„Aus einem Land, in dem alle so aussehen wie du.“
Er runzelte die Stirn. „So ein Land gibt es?“
„Ja“, entgegnete ich knapp.
„Und du bist dort geboren?“
„Ja.“
„Bist du seiner Sprache mächtig?“
„Ja.“
„Bist du mit seinen Bräuchen vertraut?“
„Ja.“
„Und dich haben sie behandelt, wie einen Fremden?“
„Ja.“
Es klang wie ein Verhör und wurde mir allmählich unheimlich. Doch der Schwarze schien mit meinen Auskünften befriedet und schwieg einen Moment, in dem er nachdachte.
„Du bist wie ich“, sagte er schließlich. „Ich bin hier geboren, ich spreche ihre Sprache, ich weiß, wie man hier lebt, und trotzdem verachten sie mich.“
Ich nickte verständnisvoll. „Es ist grausam von der Welt, die Menschen in schwarz und weiß zu teilen, sodass sie einander missbilligen. Lass uns tauschen und in Frieden leben. Ich nehme hier deinen Platz ein und du den meinen in meinem Land.“
„Das geht nicht“, antwortete der Schwarze. „Ich kenne deren Sprache nicht, ebenso wenig wie deren Bräuche und Geschichten. Sie werden mich behandeln wie einen Fremden.“
„Das glaube ich nicht“, erwiderte ich. „Du hast deren Hautfarbe.“
„Glaubst du wirklich, dass es die Farbe ist, auf die es ankommt? Sieh, ich bin ein Weißer mit einer schwarzen Haut. Du bist ein Schwarzer mit einer weißen Haut. Nichts und niemand wird daran etwas ändern können. Es ist unser Schicksal, anders zu sein.“
Durch die Augen der anderen
(von Salissa - Unentschieden)
" Das Geheimnis der Selbstliebe liegt nicht darin,
sich immer mehr zu lieben,
sondern sich immer weniger zu hassen ."
( Zitat von unbekannt)
Ich weiß genau, was der Spiegel mir zeigen würde, sollte ich nach all den vergangenen Monaten den Leichtsinn besitzen, in einen hineinzuschauen. Um zu wissen, wer ich bin, brauche ich keinen Spiegel.
Eine junge Frau mit blasser Haut und Gesichtszügen, die man ehrlicherweise eher als kantig anstatt als sanft interpretieren würde. Ihre Augen sind von einem dunklen Blau, eine ganz gewöhnlich Farbe, die poetische Vergleiche mit dem verträumten Blau der Wellen oder dem azurfarben Himmel gar nicht erst aufkommen lässt. Es liegen Schatten um diese Augen, denen jedes Funkeln fehlt. Dazu einen Mund, der wenig zum Küssen einlädt und braunes Haar, stumpf und glatt ohne jeden Schwung. Wie langweilig sie ausschaut, wie gewöhnlich!
Das Mädchen sieht alt aus, als habe eine geheimnisvolle Macht ihm alle Energie, die eine junge Frau ihres Alters eigentlich besitzen sollte, ausgesaugt.
Muss ich noch mehr sagen? Nein, ich glaube, das reicht. Das ist es, was ich bin, wie ich mich sehe.
Ich bin nichts Besonderes, weder die Art Mensch, die euch sofort wegen ihres einnehmenden Äußeren im Gedächtnis bleiben würde noch jemand, mit dem ihr gerne befreundet wäret. Ich wäre ja nicht einmal gerne selbst mein Freund.
Mein Therapeut sagte mir, ich solle mir vorstellen, es gebe einen Spiegel, nicht irgendeinen Spiegel, sondern ein ganz besonderes Exemplar dieser Gattung, der fähig wäre, die Seele eines Menschen abzubilden. In unserer letzten Sitzung hatte er mich ermutigend angelächelt und mir zu unserem nächsten Treffen aufgetragen, aufzuschreiben, was ich in diesem Spiegel erblicken würde. Als ich schon halb aus der Tür getreten war, wurde ich zurückgerufen.
" Erledige das in Ruhe, Nela, hörst du? Lass dir Zeit. " Ich wurde mit einem strengen und zugleich mitfühlenden Blick gemustert. "Es geht nicht darum, in alte Denkmuster zurückzuverfallen."
Nein, natürlich nicht. Bereits in dem Augenblick, in dem die Praxistür hinter mir ins Schloss fiel, malte ich mir aus, was jener verheißungsvolle Spiegel mir zeigen würde: ein Meer aus Grau; eine Landschaft voller verdörrter Bäume, die im ewigen Schnee versinken. Eine schöne Allegorie, oder?
Was meinen Sie, Doktor, der Sie überzeugt sind, mich so gut zu kennen?
Müde lasse ich mich in meinen Sessel in Nähe des einzigen Fensters in meinem kleinen Dachgeschosszimmer sinken. Ich sollte den Sarkasmus lassen, er wird in Zukunft nicht viel weiterhelfen. Aber wie sollte ich mich und mein Leben dann betrachten?
Schonungslos?
Ehrlich?
In Wahrheit fürchtete ich mich mehr als alles andere davor, in einen derartigen Spiegel zu blicken. Meiner Seele sind alle Farben abhanden gekommen, ausgelöscht von dem Sturm aus Qual und Zweifeln, der in meinem Inneren tobt und mich schließlich in die Therapie gebracht hat. Von einem anfangs heftigen Wind hatte sich der Sturm, genährt von Selbsthass und Unsicherheit, im Laufe der Jahre zu einem Orkan entwickelt und seinen Höhepunkt erreicht an jenem Tag, an dem . . . an dem ...
Verdammt, warum fiel es mir so schwer, den Satz zu Ende zu denken? An jenem Tag, an dem ich mein Leben hatte beenden wollen. Verflixt und zugenäht.
Ich weine, während ich an die leere Tablettenschachtel neben mir denke, an die ausdruckslose Miene meines Vaters neben mir am Krankenhausbett und die stummen Selbstvorwürfe im Gesicht meiner Mutter. Ich erinnere mich an die leise Frage meines Bruders: "Mama, warum hat Nela all die Tabletten genommen? " und die Fassungslosigkeit meiner Freunde.
Ich versinke in meinem Sessel und weine, weine, weine.
Ich wünsche mir, es gebe einen Spiegel, einen wahrhaften Zauberspiegel, der uns zeigen könnte, wie geliebte Menschen uns sehen.
Eine junge Frau mit heller Haut und Gesichtszügen, die man als energisch und vertrauenswürdig interpretieren würde. Ihre Augen sind von einem dunklen Blau, einer ganz individuellen Farbe, die keine Vergleiche scheuen muss, weil sie eben genauso besonders ist wie der Mensch, zu dem sie gehört. Es liegen Lachfältchen um diese Augen und dunkle Ringe, die darauf hinweisen, dass hier jemand harte Arbeit nicht scheut und auch spät in der Nacht noch ein offenes Ohr für alle Freunde hat, die Hilfe benötigen. Dazu ein Mund, der irgendwann das Herz eines Jungen höher schlagen lassen wird und braunes Haar, das elegant auf die Schultern fällt.
Wie einzigartig sie ausschaut, wie sympathisch!
Das Mädchen wirkt vollkommen im Reinen mit sich, als habe eine geheimnisvolle Macht ihm mehr Weisheit verliehen, als eine junge Frau ihres Alters eigentlich besitzt.
Muss ich noch mehr sagen? Nein, ich glaube, das reicht. Das ist es, was sie ist, wie ihre Freunde sie sehen.
Diese junge Frau ist etwas Besonderes, die Art Mensch, die man nie vergessen würde und die nicht den Fehler macht, sich selbst oder andere nach dem Äußeren zu beurteilen. Ihre Freunde sind stolz, sie kennen zu dürfen.
Die Seele ihrer Freundin würden sie als ein Meer aus Farben beschreiben, als eine bunte Sommerlandschaft voller blühender Bäume, die in die Wärme der Sonne eintauchen. was für eine schöne Allegorie.
Ich wünschte, es gebe einen Spiegel, einen wahrhaften Zauberspiegel, der uns Zweifelnden zeigen könnte, wie geliebte Menschen uns sehen. Damit wir lernen würden, dass wir anders sind, als es für uns selbst den Anschein hat und man manchmal im Leben durch die Augen der anderen schauen muss, um die Wahrheit zu erkennen.
20.4. 2009!
Viel Spaß ^_^
Ist weiß besser als schwarz?
-
Nein, aber anders
(von Heralina - Unentschieden)
Hallo! Mein Name ist Olakunde. Das ist afrikanisch und bedeutet „der Tapfere ist angekommen“. Ich stamme nämlich selbst vom „schwarzen Kontinent“. Aber meine Haut ist weiß. Weiß wie deine.
Nein, es liegt nicht an einem Gendefekt oder Ähnlichem. Ich bin ein Findelkind.
Wer meine leiblichen Eltern sind, weiß niemand. Nur, dass sie weiß waren. Weiß wie ich. Vermutlich wurden sie vom Sumpffieber dahingerafft und ich habe als Einziger überlebt.
Meine Adoptiveltern in dem nigerianischen Dorf Mahlasela sagten, es sei ein Wunder. Sie waren sehr liebenswürdig zu mir und behandelten mich nicht anders, als ihre eigenen Kinder. Wenn man mich nicht mitzählt, waren es zwölf, während der Zeit, die ich bei ihnen lebte. Sicher kamen nicht alle durch. Es gab immer ein trauriges Fest, wenn jemand gestorben war. Da wurde viel gesungen und gebetet. Der Leichnam, ob von Mann, Frau oder Kind, wurde auf einem Holzfloß zu dem großen Fluss Niger getragen, dort entzündet und dann zu Wasser gelassen.
Aber vor allem die Ältesten des Stammes wollten mich nur ungern an ihren Zeremonien teilhaben lassen. Sie sagten, dass es die Totengeister verärgern könnte, wenn ein Weißer den Traditionen zusähe, sodass den Verstorbenen der Zutritt ins Jenseits verwehrt bliebe und ihre Seelen keine Ruhe finden würden.
Meine Eltern allerdings setzten sich dafür ein, dass ich nicht außen vor behandelt wurde, und veranlassten so auch meine Anwesenheitserlaubnis bei traditionellen Zeremonien.
Trotzdem gab es im Stamm immer noch sehr viele, die mich nicht als einen der Ihren akzeptieren wollten. Ich verwendete ihre Sprache, ich kannte ihre Geschichten, ihre Bräuche, ich war dort aufgewachsen wie sie und doch blieb ich für sie immer ein Fremder. Während die Erwachsenen hinter vorgehaltener Hand Gerüchte über mich und meine Herkunft entfachten, trieben die Kinder öffentlich Spott über meine Hautfarbe und lachten. Sie sagten Dinge wie: „Als Oshumare den starken Regen angekündigt hat, bist du trotzdem hinausgegangen und hast getanzt. Als Strafe für deinen Ungehorsam hat das göttliche Wasser dir die Farbe ausgewaschen!“
Oshumare ist in dem Glauben des Stammes ein sehr hoher Gott gewesen. Eine Legende besagt, dass vor vielen, vielen Jahren eine große Dürre das Land heimgesucht hatte. Die Menschen baten so inständig den großen Gott um Wasser zum Trinken und für die Ernte, sodass er sich erweichen ließ und einen gewaltigen Regenguss ankündigte. Aber er warnte, dass jeder sich in einen festen Unterschlupf zurückziehen solle, weil die himmlische Wasserflut so gewaltig sein werde, dass sie einen Menschen, der draußen herumlief, mühelos erschlagen könne.
Man behauptete also, dass ich Glück gehabt hätte, da der regen mir bloß die Farbe und nicht auch noch das Leben genommen hatte.
Meine Altersgenossen waren gerade in den Mannestand aufgenommen worden – mir wurde die Ehre aufgrund meines Ungehorsams gegenüber einem Gott untersagt und ich würde auf ewig ein Junge bleiben müssen – als uns eine Reisegruppe mit einer Menge beladener Lasttiere besuchte. Ich war fasziniert von ihnen, denn die Männer waren alle weiß.
Nur wenige aus dem Stamm trauten sich, mit ihnen zu kommunizieren. Die meisten verbaten ihren Kindern sogar, sich zu zeigen, während die Fremden da waren.
Anfangs hatte auch ich ziemlich viel Angst und hielt mich fern. Doch als ich sah, dass einige Erwachsene - allen voran meine Adoptiveltern - abends am Feuer mit ihnen scherzten und Spaß hatten, gesellte ich mich schon nach wenigen Tagen dazu. Die weißen Gäste blieben mehrere Wochen und lernten im Laufe der Zeit, unsere Sprache besser zu verstehen und zu sprechen. Bald konnte ich mich mit ihnen richtig unterhalten. Und wenn wir die Worte des anderen einmal nicht zu deuten vermochten, gebärdeten wir uns mit Händen und Füßen. Das war immer sehr lustig und wir hatten viel zu lachen.
Nachdem der Sommer vorbei war, teilte uns der Anführer der Gruppe mit, dass es für sie nun an der Zeit war, aufzubrechen. Ich war traurig, denn die Fremden kannten viele interessante Geschichten. Zum Beispiel hatten sie einmal davon erzählt, dass es bei ihnen Transportmittel aus Blech gab, die von selbst vorwärtskamen, ohne dass sie von einem Tier gezogen wurden. Oder dass es Häuser gab, in denen Bilder auf einer Rolle mithilfe von Licht auf eine Wand geworfen und dort ganz schnell abgespielt wurden, sodass es aussah, als würden sie sich bewegen. Diese Gebäude nannten sie Kinos. Sie sprachen auch davon, dass die Häuser, in denen sie lebten, mehrere Zimmer hatten und dass es in manchen Becken gab, in die das Wasser von selbst hineinlief, wenn man bloß an einer Schraube drehte.
Mir kam es so vor, als ob diese weißen Menschen aus einer anderen Welt kämen. Auch die anderen Angehörigen des Stammes, die den Mut gehabt hatten, aufmerksam zuzuhören, staunten in Ehrfurcht.
Als die Fremden nun gehen wollten, bat ich sie, mit ihnen kommen zu dürfen. Ich mochte endlich unter Menschen leben, die aussahen, wie ich.
Nach längerem Überlegen stimmten sie zu, aber meine schwarzen Brüder und Freunde wiesen sie ab. Sie sagten, dass die in ihrem Land nicht besonders gerne gesehen würden. Auch gaben sie mir einen anderen Namen, um zu verschleiern, woher ich kam. Sie nannten mich Sven. Später erfuhr ich, dass das „junger Krieger“ bedeutet und ich war ihnen dankbar dafür.
Die Reise dauerte sehr lange, doch endlich erreichten wir mit einem großen Schiff die Stadt, aus der die Weißen kamen. Vielleicht stammten auch meine Eltern von hier, Mir wurde schnell klar, dass die Suche nach ihnen aussichtslos war. Die Stadt hier erschien mir so riesig, dass mein altes Dorf mehr als eine Million Mal dorthinein gepasst hätte.
Von den Dingen, die es hier angeblich gab, bekam ich nur wenig zu sehen. Vereinzelt ein paar dieser Metallmonster, auf denen die Leute ritten, aber das war alles. Keine bewegten Bilder, kein fließendes Wasser und auch kein Licht, das auf Knopfdruck statt mit Feuer funktionierte.
Das und dass die Fremden mich einfach im Stich gelassen hatten, brachte mich auf den Gedanken, dass sie mich von vorne bis hinten betrogen hatten. Ich war enttäuscht und stand nun gänzlich ohne Material da. Außer der Jacke und der Hose, die man mir statt des bunten Tuches gegeben hatte, hatte ich nichts mehr.
Dieses Land hier war ein sehr unfreundliches Land. Wenn daheim jemand Hunger litt, schenkte man ihm etwas zu essen. Aber hier wurde man ausgelacht und verprügelt, wenn man auch nur um Almosen bat.
Eines Tages, als ich wieder einmal durch die Straßen zog und im Müll nach etwas Essbarem suchte, sah ich, wie vier weiße Männer jemanden gepackt hatten und ihn gegen eine Hauswand drückten, während sie ihn mit einem Messer bedrohten. Er war schwarz.
Mutig ging ich auf sie zu. Was außer meinem unlebenswerten Leben hatte ich schon zu verlieren?
„Hallo“, sagte ich in gebrochenem Englisch, der Sprache, die man hier sprach und die ich einwenig von den Fremden gelernt hatte, „was wollt ihr von dem Mann?“
Sofort wurde auch ich in den Schwitzkasten genommen und ein anderer tastete mich ab.
„Du kannst den loslassen, der hat nix“, meinte er schließlich.
Der, der mich festhielt, brummte und machte seinen Griff locker, sodass ich mich ihm entziehen konnte. Da reagierten sie plötzlich ganz schnell, stachen auf den schwarzen Mann ein, rissen einen kleinen Beutel an sich und rannten aus der Gasse fort.
Erschrocken starrte ich den Dunkelhäutigen an. Unter seinem schmutzigen Hemd quoll Blut hervor und er hielt sich die Brust.
„Danke“ sagte er und setzte sich an die Hauswand lehnend hin. Ich nickte ihm zu und ließ mich neben ihm nieder.
„Kann ich dir helfen?“, fragte ich, weil er mir leidtat.
Er schüttelte stumm den Kopf und nach einer Weile richtete er eine Frage an mich. „Wie kommt ein Weißer dazu, einem wie mir helfen zu wollen?“, sagte er.
„Warum? Du bist ein Mensch, wie ich“, erwiderte ich.
Der Mann hielt den Blick gesenkt und antwortete: „Ich bin schwarz.“ Es klang beinahe so, als würde er sich dafür schämen.
„Na und? Was würde ich dafür geben, deine Haut zu haben. In meiner Heimat wurde ich ständig gehänselt, weil ich anders aussah als sie.“
Er blickte auf und sah mich erstaunt an. „Woher kommst du?“, fragte er dann.
„Aus einem Land, in dem alle so aussehen wie du.“
Er runzelte die Stirn. „So ein Land gibt es?“
„Ja“, entgegnete ich knapp.
„Und du bist dort geboren?“
„Ja.“
„Bist du seiner Sprache mächtig?“
„Ja.“
„Bist du mit seinen Bräuchen vertraut?“
„Ja.“
„Und dich haben sie behandelt, wie einen Fremden?“
„Ja.“
Es klang wie ein Verhör und wurde mir allmählich unheimlich. Doch der Schwarze schien mit meinen Auskünften befriedet und schwieg einen Moment, in dem er nachdachte.
„Du bist wie ich“, sagte er schließlich. „Ich bin hier geboren, ich spreche ihre Sprache, ich weiß, wie man hier lebt, und trotzdem verachten sie mich.“
Ich nickte verständnisvoll. „Es ist grausam von der Welt, die Menschen in schwarz und weiß zu teilen, sodass sie einander missbilligen. Lass uns tauschen und in Frieden leben. Ich nehme hier deinen Platz ein und du den meinen in meinem Land.“
„Das geht nicht“, antwortete der Schwarze. „Ich kenne deren Sprache nicht, ebenso wenig wie deren Bräuche und Geschichten. Sie werden mich behandeln wie einen Fremden.“
„Das glaube ich nicht“, erwiderte ich. „Du hast deren Hautfarbe.“
„Glaubst du wirklich, dass es die Farbe ist, auf die es ankommt? Sieh, ich bin ein Weißer mit einer schwarzen Haut. Du bist ein Schwarzer mit einer weißen Haut. Nichts und niemand wird daran etwas ändern können. Es ist unser Schicksal, anders zu sein.“
VS
Durch die Augen der anderen
(von Salissa - Unentschieden)
" Das Geheimnis der Selbstliebe liegt nicht darin,
sich immer mehr zu lieben,
sondern sich immer weniger zu hassen ."
( Zitat von unbekannt)
Ich weiß genau, was der Spiegel mir zeigen würde, sollte ich nach all den vergangenen Monaten den Leichtsinn besitzen, in einen hineinzuschauen. Um zu wissen, wer ich bin, brauche ich keinen Spiegel.
Eine junge Frau mit blasser Haut und Gesichtszügen, die man ehrlicherweise eher als kantig anstatt als sanft interpretieren würde. Ihre Augen sind von einem dunklen Blau, eine ganz gewöhnlich Farbe, die poetische Vergleiche mit dem verträumten Blau der Wellen oder dem azurfarben Himmel gar nicht erst aufkommen lässt. Es liegen Schatten um diese Augen, denen jedes Funkeln fehlt. Dazu einen Mund, der wenig zum Küssen einlädt und braunes Haar, stumpf und glatt ohne jeden Schwung. Wie langweilig sie ausschaut, wie gewöhnlich!
Das Mädchen sieht alt aus, als habe eine geheimnisvolle Macht ihm alle Energie, die eine junge Frau ihres Alters eigentlich besitzen sollte, ausgesaugt.
Muss ich noch mehr sagen? Nein, ich glaube, das reicht. Das ist es, was ich bin, wie ich mich sehe.
Ich bin nichts Besonderes, weder die Art Mensch, die euch sofort wegen ihres einnehmenden Äußeren im Gedächtnis bleiben würde noch jemand, mit dem ihr gerne befreundet wäret. Ich wäre ja nicht einmal gerne selbst mein Freund.
Mein Therapeut sagte mir, ich solle mir vorstellen, es gebe einen Spiegel, nicht irgendeinen Spiegel, sondern ein ganz besonderes Exemplar dieser Gattung, der fähig wäre, die Seele eines Menschen abzubilden. In unserer letzten Sitzung hatte er mich ermutigend angelächelt und mir zu unserem nächsten Treffen aufgetragen, aufzuschreiben, was ich in diesem Spiegel erblicken würde. Als ich schon halb aus der Tür getreten war, wurde ich zurückgerufen.
" Erledige das in Ruhe, Nela, hörst du? Lass dir Zeit. " Ich wurde mit einem strengen und zugleich mitfühlenden Blick gemustert. "Es geht nicht darum, in alte Denkmuster zurückzuverfallen."
Nein, natürlich nicht. Bereits in dem Augenblick, in dem die Praxistür hinter mir ins Schloss fiel, malte ich mir aus, was jener verheißungsvolle Spiegel mir zeigen würde: ein Meer aus Grau; eine Landschaft voller verdörrter Bäume, die im ewigen Schnee versinken. Eine schöne Allegorie, oder?
Was meinen Sie, Doktor, der Sie überzeugt sind, mich so gut zu kennen?
Müde lasse ich mich in meinen Sessel in Nähe des einzigen Fensters in meinem kleinen Dachgeschosszimmer sinken. Ich sollte den Sarkasmus lassen, er wird in Zukunft nicht viel weiterhelfen. Aber wie sollte ich mich und mein Leben dann betrachten?
Schonungslos?
Ehrlich?
In Wahrheit fürchtete ich mich mehr als alles andere davor, in einen derartigen Spiegel zu blicken. Meiner Seele sind alle Farben abhanden gekommen, ausgelöscht von dem Sturm aus Qual und Zweifeln, der in meinem Inneren tobt und mich schließlich in die Therapie gebracht hat. Von einem anfangs heftigen Wind hatte sich der Sturm, genährt von Selbsthass und Unsicherheit, im Laufe der Jahre zu einem Orkan entwickelt und seinen Höhepunkt erreicht an jenem Tag, an dem . . . an dem ...
Verdammt, warum fiel es mir so schwer, den Satz zu Ende zu denken? An jenem Tag, an dem ich mein Leben hatte beenden wollen. Verflixt und zugenäht.
Ich weine, während ich an die leere Tablettenschachtel neben mir denke, an die ausdruckslose Miene meines Vaters neben mir am Krankenhausbett und die stummen Selbstvorwürfe im Gesicht meiner Mutter. Ich erinnere mich an die leise Frage meines Bruders: "Mama, warum hat Nela all die Tabletten genommen? " und die Fassungslosigkeit meiner Freunde.
Ich versinke in meinem Sessel und weine, weine, weine.
Ich wünsche mir, es gebe einen Spiegel, einen wahrhaften Zauberspiegel, der uns zeigen könnte, wie geliebte Menschen uns sehen.
Eine junge Frau mit heller Haut und Gesichtszügen, die man als energisch und vertrauenswürdig interpretieren würde. Ihre Augen sind von einem dunklen Blau, einer ganz individuellen Farbe, die keine Vergleiche scheuen muss, weil sie eben genauso besonders ist wie der Mensch, zu dem sie gehört. Es liegen Lachfältchen um diese Augen und dunkle Ringe, die darauf hinweisen, dass hier jemand harte Arbeit nicht scheut und auch spät in der Nacht noch ein offenes Ohr für alle Freunde hat, die Hilfe benötigen. Dazu ein Mund, der irgendwann das Herz eines Jungen höher schlagen lassen wird und braunes Haar, das elegant auf die Schultern fällt.
Wie einzigartig sie ausschaut, wie sympathisch!
Das Mädchen wirkt vollkommen im Reinen mit sich, als habe eine geheimnisvolle Macht ihm mehr Weisheit verliehen, als eine junge Frau ihres Alters eigentlich besitzt.
Muss ich noch mehr sagen? Nein, ich glaube, das reicht. Das ist es, was sie ist, wie ihre Freunde sie sehen.
Diese junge Frau ist etwas Besonderes, die Art Mensch, die man nie vergessen würde und die nicht den Fehler macht, sich selbst oder andere nach dem Äußeren zu beurteilen. Ihre Freunde sind stolz, sie kennen zu dürfen.
Die Seele ihrer Freundin würden sie als ein Meer aus Farben beschreiben, als eine bunte Sommerlandschaft voller blühender Bäume, die in die Wärme der Sonne eintauchen. was für eine schöne Allegorie.
Ich wünschte, es gebe einen Spiegel, einen wahrhaften Zauberspiegel, der uns Zweifelnden zeigen könnte, wie geliebte Menschen uns sehen. Damit wir lernen würden, dass wir anders sind, als es für uns selbst den Anschein hat und man manchmal im Leben durch die Augen der anderen schauen muss, um die Wahrheit zu erkennen.